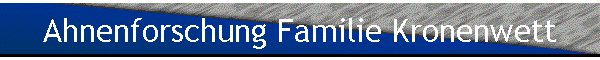|
|
|
|
Einwanderer in Langensteinbach
|
|
|
Das Wappen von
Langensteinbach deutet auf die bäuerliche Herkunft hin.
In Blau ein Schild mit einer in Silber gehaltenen, spitz nach oben
weisenden, Pflugschar. Die Kriegshandlungen des 30-jährigen Krieges (1618 -1648) und die dadurch verursachten Hungersnöte und Seuchen verheerten und entvölkerten ganze Landstriche. In Süddeutschland überlebte etwa nur ein Drittel der Bevölkerung. Nach dem 30-jährigen Krieg, also zwischen 1648 und 1688, kam es zu einer starken Einwanderungsbewegung. Zur gleichen Zeit wurden Wanderungsbewegungen aus Ober- und Niederösterreich nach Franken, Württemberg, Baden, Elsass usw., durch Katholisierung von Österreich durch die Habsburger, ausgelöst. 1624 erfolgte die Vertreibung der evangelischen Lehrer und Pfarrer aus Oberösterreich. Vor allem nach dem Ende des 30-jährigen Krieges 1648 löste der Druck auf die Bevölkerung, entweder katholisch zu werden oder das Land zu verlassen große Wanderungsbewegungen aus. Es wurden in dieser Zeit Neusiedler geworben, die sich in Langensteinbach niederlassen sollten. Die Neuansiedlung wurde vom Markgrafen aus Durlach gelenkt. So nahm man als Neubürger nur solche Leute auf, die besondere Leistungen erwarten ließen. Die meisten Neubürger kamen aus Gegenden die nicht vom Krieg betroffen waren. Der Anbau von Feldern und Weinbergen wurde vom Markgrafen von Durlach gefördert. Der Morgen Kulturland war für 2 Gulden vom markgräflichen Besitz von den Neubürgern zu erwerben. Noch im Jahre 1705 waren von den ehemals bewirtschafteten 1400 Morgen Kulturland erst 600 Morgen bewirtschaftet. Mit den Neusiedlern kamen viele neue Familiennamen nach Langensteinbach. So sind bereits im Jahre 1660 folgende neuen Familiennamen zu lesen: Busch, Geissert, Kirchenbauer, Klein, Dietz, Mayer, Flößer (aus der Wetterau), Knab (aus Böhmen), Lang, Rau, Ziegler, Kreusch, Uckele, Weber, Seutter, Grimm und viele andere. Namentlich erfasst wurden die meisten erst bei Familienstandsänderungen, bei Hauserwerb oder Besitzwechsel. Neben den Amtsprotokollen lassen sich auch noch vorhandene Pfarrbücher auswerten. Diese sind aber gerade in dieser Zeit noch lückenhaft. Häufiger Wechsel der Geistlichen und der Verwaltungsbeamten erschwerte das Verstehen und Erfassen der wohl meist in heimatlicher Mundart ausgesprochenen Familien- und Dorfnamen. Bei Einzelpersonen ohne bekannte Familienbindung wurde vielfach nur der Rufname eingetragen, bisweilen verknüpft mit dem örtlichen Hausnamen des Arbeitgebers. Durch Brände im Langensteinbacher Rathaus, sowie im Pfarrhaus sind zahlreiche Unterlagen aus der damaligen Zeit nicht mehr vorhanden. Als Fürstenbad wurde Langensteinbach bekannt, als Markgraf Karl Wilhelm von Baden (der Gründer von Karlsruhe) 1719 die Heilquelle fassen und Badeanlagen auf seine Kosten bauen ließ. Der erste Kronenwett ist nach Langensteinbach eingewandert In der Schätzungstabelle von 1724 werden folgende Namen genannt: Familie Simon Cronewett und Familie Georg Kronenwett (Sohn), Johann Krafft Flößer (Schultheiß und reichster Bürger), Hanß Georg Becker (Amtmann), Christian Strobel (Bäcker), Hans Jacob Nagel, Martin Stoll, Caspar Lutzle, Hans Jacob Seuther (auch Seiter geschrieben), Hans Michael Seuther (musste als Taglöhner arbeiten), Andreas Meyer (Langensteinbacher Schneider), Michel Scheidle, Johann Ludwig Denninger (alteingesessener Langensteinbacher), Christian Dreyer (arbeitete als Maurer), Heinrich Meyer (Zimmermann), Carl Bach (Landwirt ohne handwerkliches Nebeneinkommen), Hans Wilhelm Knab (Leineweber), Witwe von Hanß Martin Rau, Johannes Ückelin (Ückele), Hans Martin Miller (beide Landwirte), Hans Philipp Ückelin (Schumacher, hatte das zweitgrößte und -schönste Haus), Hans Georg Kürchenbauer (Kirchenbauer), Christian Gebhard, Johannes Guthel, Witwe von David Gebhard, Hans Michel Ückelin (Schumacher, Sohn von Hanß Philipp), Witwe des Hans Christof Rau, Hans Philipp Rist aus Linkenheim, Ludwig Wagner, Witwe von Michel Schäfer, Witwe von Hanß Caspar Rau, Hans Raunßer, Anna Barbara Güntherin, Johannes Rettau (einer der Ärmsten), Elisabetha Ristin, Johann Philipp Flößer, Simon Mitzau, Mathäus Rieß (Bäcker), Hans Georg Ried (Wagner), Hans Michael Knab, Cristina Barbara Schlittbauerin, Conrad Knab (erbte das Haus von Schlittbauerin), Hans Martin Walther (einer der Ärmsten), Caspar Lutzle, Wilhelm Schmid, Hans Krafft Ried, Hans Krafft Kirchenbauer, Mathäus Lichtenfels, Martin Stoll, Jakob Scheidle (Metzger), Magdalena Flößerin, Bernhard Nagel, Michel Roth (Leineweber), Hans Philipp Rau, Lorenz Rupp (Jäger der Forstei). Der gesamte Vermögensanschlag stellte eine Summe von 14.756 Gulden dar, womit Langensteinbach zu den wohlhabendsten Gemeinden der Durlacher Ländereien zählte.
|
| Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen auch folgende Unternehmen aus dem Raum Karlsruhe. Sie stärken mit Ihren Einkäufen unseren Wirtschaftsraum und sichern dadurch auch Arbeitsplätze. | |||||
|
|
|
|
|
 |
|